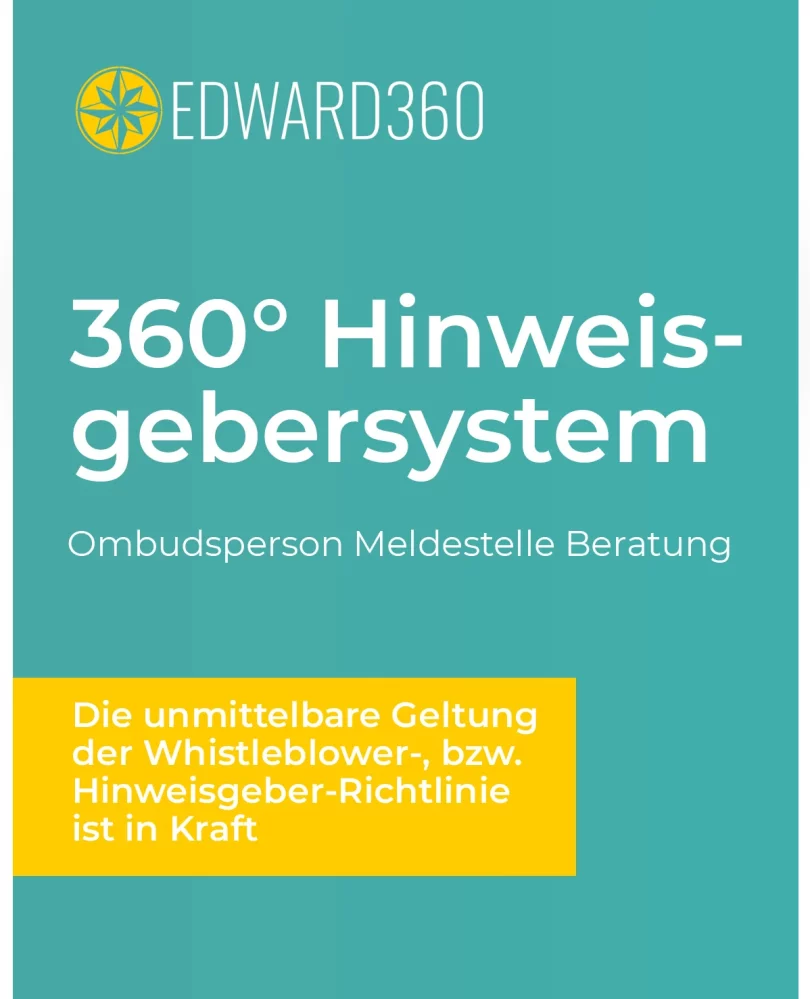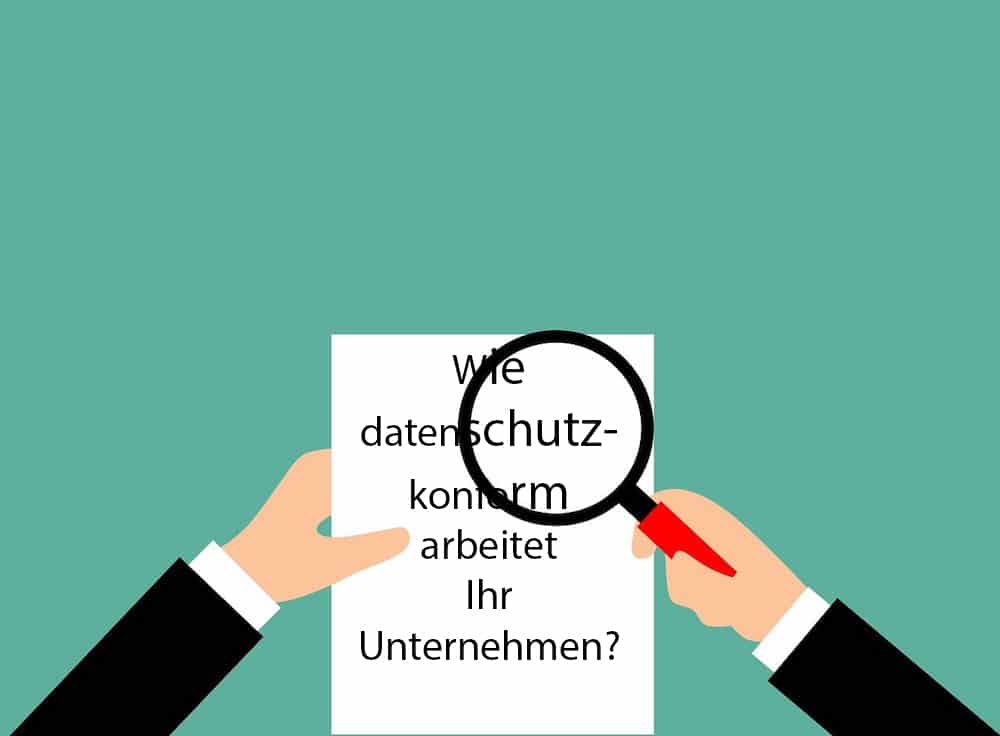Das Hinweisgeberschutzgesetz, auch Whistleblowergesetz genannt, ist seit dem 17. Dezember 2023 in Kraft. Das Hinweisgebersystem muss jetzt eingeführt werden, auch für Unternehmen ab 50 Mitarbeiter.
Nach langem Warten ist nun endlich das Hinweisgeberschutzgesetz im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Es ist ab 17. Dezember 2023 in Kraft und betrifft Unternehmen ab 50 Beschäftigten. Deutsche Unternehmen ab 250 Mitarbeitenden haben seit Juni die Pflicht, ein Hinweisgeber System und eine sichere, DSGVO-konforme interne Meldestelle einzurichten und eine Ombudspersonen bzw, einen Meldestellenbeauftragten zu benenne.

Sie müssen den Meldestellenbeauftragten benennen.

Sie müssen die Meldestelle für persönliche, telefonische und elektronische Meldungen einrichten und kommunizieren.

Sie benötigen eine Meldestellensoftware für anonyme Meldungen.
Die wichtigsten Änderungen zum Vorschlag des Vermittlungsausschusses vom 09.05.2023
Am 09.05.2023 hat der Vermittlungsausschuss Änderungen am Gesetzesentwurf zum Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) abgegeben.
Im Mai wurde nun das Gesetz final im Bundestag verabschiedet. Folgend finden Sie von uns die wichtigsten Änderungen zusammengefasst:
- Gesetz tritt nach Beschluss in Kraft – Bußgelder werden nach 6 Monaten verhängt
- Bußgelder werden von 100.000 EUR auf 50.000 EUR reduziert
- Anonyme Meldung müssen ggf. zu bestimmten Sachverhalten mögliche sein (andere Gesetze und Rechtsvorschriften z. B. ggf. Geldwäsche tba) und sollten grundsätzlich bearbeiten werden.
- Konkretisierung der Beweislastumkehr bei Repressalien gegenüber Beschäftigten.
- Melder müssen in einem direkten Vertragsverhältnis zum Unternehmen stehen.
Das Hinweisgeberschutzgesetz ist in Kraft
Als Reaktion auf die Enthüllungsskandale, wie zum Beispiel die Diesel-Affäre und die Panama Papers, sowie durch die Enthüllungen von Edward Snowden und Julian Assange, wurde die EU-Whistleblower-Richtlinie ins Leben gerufen, um das mutige Handeln von Whistleblowern anzuerkennen, zu schützen und um den Ansprüchen an die Wirtschaftsethik gerecht zu werden. Zudem soll die Regelung zu Aufklärung und Vermeidung von Rechtsverstößen und Missständen beitragen. Einheitliche Standards zum Schutz der Hinweisgeber soll das Melden von Verstößen in Unternehmen bei einer Meldestelle fördern. Dabei zielt das Hinweisgeberschutzgesetz insbesondere auf die Bereiche der Auftragsvergabe, Produktsicherheit, Lebensmittelsicherheit, Vermeidung illegaler Einfuhr- und Vertriebsaktivitäten und Terrorismusfinanzierung sowie Umweltschutz ab.
Sie müssen als verantwortliche Stelle entscheiden, ob Sie eine interne oder externe Ombudsperson als Meldestelle im Unternehmen zur Wahrung der Anonymität und zum Schutz des Hinweisgebers benennen.
Unser Hinweisgebersystem EDWARD360 setzt alle aktuellen Anforderungen des HinSchG um. Die Einführung eines Hinweisgebersystems sollte nicht länger hinausgeschoben werden!
Die Tätigkeit der Ombudsperson in der Meldestelle besteht aus folgenden Aufgaben
- Neutraler Mittler zwischen Unternehmen und Hinweisgeber
- Vertrauliche Entgegennahme von Hinweisen zu Missständen
- Schutz der Identität des Hinweisgebers unter Wahrung der Anonymität gegenüber dem Unternehmen
- Erstbewertung und Einstufung der Glaubwürdigkeit und Schlüssigkeit des Hinweises
- Unabhängigkeit gegenüber der verantwortlichen Stelle
- Betreuung des Hinweisgebersystems
- Verantwortlich für die Hinweisgebersoftware
Vorteile einer internen Ombudsperson:
- Personelle Ressourcenplanung
- direkte und schnelle Reaktionsfähigkeit
- weitergehende Kenntnisse von internen Prozessen
Nachteile einer externe Ombudsperson:
- Vorbehalte der Mitarbeiter bezüglich der Vertraulichkeit bei interner Bearbeitung, wenn unklar, ob und inwieweit Vorgesetzte in Unregelmäßigkeiten verwickelt sind
- Möglichkeit Befangenheit bei der Bewertung von Meldungen
Vorteile einer externen Ombudsperson:
- Unbefangenheit und Neutralität bei der Bewertung durch externe Bearbeitung
- keine Vorbehalte gegenüber der Vertraulichkeit des Dienstleisters zum Schutz des Hinweisgebers
- Externe Dienstleister stehen rund um die Uhr zur Verfügung
- Kein zusätzlicher Personalaufbau nötig
- Unabhängigkeit von Weisungen des Unternehmens
- Durch Unabhängigkeit können Missstände deutlicher kommuniziert werden
Nachteile einer externen Ombudsperson:
- Auswahl des geeigneten Dienstleisters unter Berücksichtigung des fachlichen und persönlichen Anforderungsprofils
Adressaten und Anwendungsbereiche vom Hinweisgebersystem
Die Whistleblower-Richtlinie verpflichtet Unternehmen, geeignete, interne Meldekanälen für die Meldung von Compliance-Verstößen einzurichten. Die Pflicht gilt laut Hinweisgeberschutzgesetz für Unternehmen der Privatwirtschaft mit mindestens 50 Angestellten, für Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohnern und für alle privaten Unternehmen in Bereichen Finanzdienstleistung, Finanzprodukte, Finanzmärkte.
Als „Hinweisgeber“ gelten natürliche Personen, die im Zusammenhang mit ihrer Arbeitstätigkeit erlangte Informationen melden oder offenlegen. Doch sind vom Anwendungsbereich zum Beispiel auch BewerberInnen, ehemalige Beschäftigte, LeiharbeitnehmerInnen, Selbstständige, LieferantInnen, Organmitglieder umfasst.
Hinsichtlich der Verstöße, die gemeldet werden dürfen, beschränkt sich die Richtlinie auf unionsrechtliche Verstöße. Es ist aber mit einer deutlichen Ausweitung des Anwendungsbereichs in Deutschland zu rechnen.
Verschiedene Meldeverfahren
Das Hinweisgeberschutzgesetz beschreibt das interne Meldeverfahren, welches von Unternehmen zu errichten und zu unterhalten ist. Zudem soll es auch externe Meldeverfahren geben, welche durch Behörden bereitgestellt werden. Dabei kann sich der Hinweisgeber frei entscheiden, ob er einen Hinweis über einen internen oder externen Meldekanal über das entsprechende Hinweisgebersystem abgibt. Dabei soll eine Gleichrangigkeit bestehen, und den Angestellten die freie Wahl gelassen werden. Der dritte Meldeweg ist die Offenlegung. Darunter ist das öffentliche Zugänglichmachen von Informationen zu verstehen, indem beispielsweise Informationen über mögliche Verstöße an die Presse weitergeleitet werden. Der Weg der Offenlegung ist jedoch subsidiär und darf vom Hinweisgeber nur beschritten werden, wenn weder auf interne noch auf externe Meldungen innerhalb einer Höchstfrist geeignete Maßnahmen ergriffen wurden, oder bei unmittelbarer Gefährdung des öffentlichen Interesses ist, oder wenn besondere Umstände vorliegen.
Bereitstellung Hinweisgebersystem
Als mögliche interne Meldekanäle sind vorgegeben: Mailboxbasierte Telefon-Hotlines, webbasierte Meldesysteme, sowie die Kooperation mit externen Dritten, wie zum Beispiel Anbieter von Meldeplattformen und / oder Ombudspersonen als Ansprechpartner. Für alle Hinweisgebersysteme gilt Vertraulichkeit, einfacher Zugang und Verständlichkeit. Bei der Einrichtung eines Meldeverfahrens spricht viel für die Benennung eines externen Dienstleisters als Ansprechpartner. Denn so kann für die Angestellten das Vertrauen in die Neutralität, auch hinsichtlich des Ergreifens und Vorantreibens von Folgemaßnahmen, am ehesten geschaffen werden. Dies wiederum kann Angestellte dazu motivieren, interne Meldestelle zu bevorzugen und beugt so mögliche Reputationsschäden durch eine externe Meldung oder Offenlegung vor.
Ausgestaltung des internen Meldeweges mittels Hinweisgebersystem
Die Meldung muss sowohl schriftlich als auch mündlich ermöglicht werden; auf Ersuchen des Hinweisgebers muss zudem eine physische Zusammenkunft innerhalb eines angemessenen Zeitraums ermöglicht werden. Vertraulichkeit der Identität des Hinweisgebers und ggf. Dritter, die in der Meldung erwähnt werden, muss gewahrt bleiben. Es muss sichergestellt sein, dass kein Zugriff auf die Meldung durch unbefugte MitarbeiterInnen erfolgt.
Nach Eingang der Meldung muss diese innerhalb von sieben Tagen bestätigt werden. Eine Rückmeldung an den Hinweisgeber muss grundsätzlich innerhalb von 3 Monaten erfolgen. Eine unparteiische Person oder Abteilung muss als zuständige Stelle für die Folgemaßnahmen (interne Ermittlungen) zu der Meldung benannt werden. Die Gewährleistung einer Rückmeldung zu den ergriffenen Folgemaßnahmen in angemessener Zeit und eine Dokumentation des Verlaufs sind erforderlich.
Achtung! Datenschutzkonformität im Hinweisgebersystem
Für alle Vorgänge sind die Anforderungen des Datenschutzes gemäß der DSGVO zu beachten. Die Einführung von Hinweisgebersystemen kann je nach Ausgestaltung Beteiligungsrechte des Betriebsrats bzw. Personalrats auslösen (vgl. §§ 87 Abs. 1 Nr.1, Nr.6 BetrVG). Daher ist die Bestellung einer externen Ombudsperson in Personalunion mit dem Datenschutzbeauftragten eine effiziente Lösung.
Schutzmaßnahmen für Hinweisgeber
Das Hinweisgeberschutzgesetz sieht ein Verbot von Repressalien gegen den Hinweisgeber vor. Unter das Verbot fallen u. a. Suspendierungen, Entlassungen, Gehaltsminderungen, Ausstellung eines schlechten Arbeitszeugnisses, Mobbing oder Nötigung
Werden benachteiligende Maßnahmen gegen den Hinweisgeber ergriffen, so trägt der Arbeitgeber die Beweislast dafür, dass die jeweilige Maßnahme nicht auf der Meldung des Arbeitnehmers beruht.
Wir empfehlen daher u. a. eine umfassende Leistungsdokumentation der Arbeitnehmer, sowie eine Dokumentation über deren Verhalten.
Vorgesehene Sanktionen bei Nichteinhaltung des Hinweisgeberschutzgesetzes
Das Gesetz fordert von dem nationalen Gesetzgeber die Umsetzung wirksamer, angemessener und abschreckender Sanktionen für natürliche und juristische Personen, die gegen die in der Whistleblower / Hinweisgeber – Richtlinie vorgesehenen Pflichten verstoßen.
Nationale Sanktionsmaßnahmen, wie etwa Bußgeldtatbestände, wurde im Rahmen der Umsetzung in nationales Recht im Einzelnen definiert.
Darüber hinaus ist ein Schadensersatzanspruch des Hinweisgebers vorgesehen, der auch künftige finanzielle Einbußen sowie immaterielle Schäden wie Schmerzensgeld umfasst.
Beitrag vom 07.12.2022
Merkliste Whistleblowing Hinweisgebersystem
- Entscheidung zur Bestellung einer Ombudsperson
- Auswahl der geeigneten Software als Meldesystems
- Entwicklung eines Kommunikationssystems
- Sensibilisieren der Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden durch die neuen Regelungen
Was ist eine Meldestelle:
Betroffene Unternehmen müssen eine interne Meldestelle einrichten, die entweder von internen oder externen Ombudspersonen besetzt ist. Hier werden Meldungen von Hinweisgebenden über entsprechend eingesetzte Meldekanäle empfangen. Eine Meldestelle muss immer mit mind. 2 Ombudspersonen besetzt sein, die die Meldungen empfangen, verarbeiten und Maßnahmen mit den verantwortlichen Stellen in die Wege leiten.
Hinweisgebersystem und Arten von Meldekanälen:
Telefon-Hotline
Eine kostengünstige Möglichkeit, die mit wenig Aufwand implementiert werden kann. Es besteht jedoch die Verpflichtung, ein Protokoll über den Inhalt des Gesprächs zu erstellen, was zeitaufwändig sein kann. Je nach Unternehmenskultur kann auch für den Hinweisgebenden aber auch abschreckend sein, sich direkt per Telefon zu melden.
Persönliches Treffen
Eine einfach umsetzbare Möglichkeit, die allerdings gerade bei intern besetzter Meldestelle kein hohes Maß an Integrität und Vertrauen herstellt. Als alleiniger Meldekanal ist das persönliche Treffen nicht zulässig.
Hinweisgebersystem – Software
Ein eingesetztes Hinweisgebersystem als Software ist nur von externen als Meldekanal zulässig, da so die Entwickler der Software keinem Interessenkonflikt gegenüber dem betroffenen Unternehmen stehen. Es gibt bereits verschiedene Hinweisgebersysteme auf dem Markt, die teilweise auch mehrere Meldekanäle vereinen und Lösungen mit integrierter Ombudsperson, Telefon-Hotline und anonymer Kommunikation anbieten.
Ein besonderer Vorteil ist, alles aus einer Hand zu haben. Einen externen Anbieter für die Meldekanäle und Ombudsperson zu wählen, schafft gegenüber seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr Vertrauen. Oft besteht die Angst der Hinweisgebenden, dass die Meldung vielleicht an Kolleginnen oder Kollegen und gar vielleicht an die betroffene Person aus der Meldung weitergeleitet wird. Einige Hinweisgebersysteme bieten auch eine anonyme Möglichkeit zur Abgabe von Meldungen und schaffen somit vollste Integrität für den Hinweisgeber.
Hinweisgebersystem – 7 Schritte zur Implementierung:
1. Schritt: Service buchen
Sie haben bereits recherchiert und eine Auswahl getroffen, für welches Hinweisgebersystem Sie sich entschieden haben. Jetzt gilt es schnell zu handeln und den Service zu buchen. Wichtig ist zu beachten, ob lediglich die Meldekanäle über das Hinweisgebersystem abgedeckt sind oder ob auch die Ombudsstelle dadurch extern besetzt wird. Zudem müssen Sie überlegen, ob zu Ihrem unternehmen oder Organisation weitere Firmen wie Tochtergesellschaften gehören. So können Sie Ressourcen sparen und noch mehr Transparenz im gesamten Verbund schaffen.
2. Schritt: Kick-Off Termin:
Für einen optimalen Start der Zusammenarbeit sollten Sie sich vorab mit folgenden Informationen schon auseinandersetzen und zusammentragen:
Welche internen oder externen Kontaktpersonen habe ich im Unternehmen zu Compliance Themen eingesetzt?
Wer ist die zuständige Ansprechperson für eingehende Meldungen zu verschiedenen Themen?
Welche Kommunikationswege werden eingesetzt und wie werden die Meldungen von den
Ombudspersonen an die Ansprechpartner im Unternehmen weiter kommuniziert:
-
- via Software mit Zugangsberechtigungskonzept
- persönlich
- telefonisch
- postalisch
3. Schritt: Präsenzvorstellung des Hinweisgebersystems und der Ombudspersonen:
Wie funktioniert das System mit den Meldekanälen und wer sind die Ombudspersonen, die für die Bearbeitung der Meldungen zuständig sind?
- im Leitungsgremium
- an die jeweiligen Ansprechpartner
- ggfls. Betriebsrat bei Wunsch / Bedarf
4. Schritt: Sofern ein Betriebsrat vorhanden, informieren
- Kontaktdaten der Ombudspersonen und des Anbieters zum Hinweisgebersystem für Rückfragen
5. Schritt: Datenschutzfolgeabschätzung
- zusammen mit dem internen oder externen Datenschutzbeauftragten
- Informationen können ggfls. vom Anbieter angefordert werden
6. Schritt: Finale Freigabe des Hinweisgebersystems
- finale Freigabe des Services und der Ombudspersonen durch die Geschäftsleitung
7. Schritt: Implementierung des Hinweisgebersystems:
- Qualitätsmanagements einbinden für die interne Kommunikation
- Kurzanleitung zum Hinweisgebersystem und der Ombudsperson als z. B. PDF für die Veröffentlichung im: Intranet, Link auf Website, Aushang, Dokumentenmanagement-System
Fazit:
Das Hinweisgeberschutzgesetz ist eine neue Chance für Unternehmen. Wenn sich Unternehmen externe Unterstützung holen, ist die Einrichtung eines effektiven und konformen Hinweisgebersystems gut zu bewältigen.
Wir empfehlen für die Umsetzung sowohl eine externe Ombudsstelle als auch eine externe IT-gestützte Hinweisgebersoftware, um Ressourcen zu sparen und möglichst viel Vertrauen gegenüber Hinweisgebenden zu schaffen.
Anforderung Checkliste: 7 Schritte zur Implementierung eines Hinweisgebersystems
Beitrag aus 11/2021
Das Hinweisgeberschutzgesetz verpflichtet Unternehmen und Organisatoren geeignete, interne Hinweisgebersysteme für die Meldung von Compliance-Verstößen einzurichten. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten das Hinweisgebersystem auszugestalten. Sie können unabhängige Dritte als interne Ombudsperson hiermit beauftragen. Dafür spricht unter anderem, dass so das Vertrauen der Angestellten in die Neutralität bei der Bearbeitung am ehesten geschaffen werden kann. Dies wiederum kann Angestellte dazu motivieren diese Meldestelle zu bevorzugen und beugt so möglichen Reputationsschäden vor. Erfahren Sie hier mehr zum Hinweisgeberschutzgesetz.
Welche Aufgaben hat der /die externe Hinweisgeberexperte / -expertin als Meldestelle und was macht eine Ombudsperson?
Der Hinweisgeberschutz und die diesbezügliche Compliance sind komplex und vielschichtig. Die Lösung muss eine einfache und verständliche Antwort sein. Wir bieten Ihnen an, Ihre Meldestelle mit uns als externe Ombudsperson zu besetzen und Meldungen von Mitarbeiter/innen, Lieferanten und Kunden zu bearbeiten und alle Pflichten des Gesetzes zum Hinweisgeberschutz zu erfüllen. Gleichzeitig stehen wir Ihren Compliance -Beauftragten zur Seite um die Compliance im Unternehmen insgesamt zu verbessern, indem dieses den rechtlichen Rahmenbedingungen des Hinweisgeberschutzes entspricht. Unser Aufgabenfeld ist mit den Aufgaben einer Vertrauensperson also einer Ombudsperson vergleichbar.
Wir als Datenschutzbeauftragte und IT- Sicherheitsbeauftragte kooperieren mit Ihnen und Ihren Mitarbeiter/innen sowie mit Dritten (unter anderem: Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter) als Ansprechpartner zur Lösung von möglichen Missständen.
Unsere Kernaufgaben als externe Ombudsperson:
- Erfüllung der gesetzlichen Pflichten des Hinweisgeberschutzgesetzes (= Umsetzung der EU-Whistleblowing Richtlinie), Bereitstellung einer anonymen Meldestelle für potentielle Hinweisgeber (Whistleblower).
- Plausibilitätsprüfung von Meldungen.
- Wir informieren Sie über eingehende Meldungen und unser vorläufiges Prüfergebnis.
- Wir kommunizieren für Sie auf anonymer Basis mit dem Hinweisgeber. Denn Sie müssen dem Hinweisgeber / der Hinweisgeberin nach Eingang eines Hinweises innerhalb enger Fristen antworten – sonst darf der / die Hinweisgeber/in sich ausdrücklich an die Öffentlichkeit wenden, z.B. über Facebook oder die Presse.
- Optional: Wir klären den Sachverhalt mit Ihnen zusammen auf und geben konkrete Handlungsempfehlungen. Hierzu können wir uns nach dem Eingang eines Hinweises beraten und die nächsten Schritte besprechen.
- Frühwarnsystem: Wir informieren Sie über zukünftige Gesetzesänderungen, die für Ihr Unternehmen in Bezug auf Compliance relevant sind.
Zusammenfassung: Als Hinweisgebersystem Dienstleister nehmen wir Ihnen Ihre Whistleblower-Aufgaben ab.
Sie müssen ab dem Moment unser Beauftragung keinen internen Mitarbeiter mehr mit den Aufgaben der EU-Whistleblower Richtlinie betrauen.
Als Datenschutzbeauftragte und IT -Sicherheitsbeauftragte (intern / extern) sind wir zur Verschwiegenheit verpflichtet. Wir verfügen sowohl intern als auch extern gemeinsam mit unseren juristischen Partnern über eine langjährige Erfahrung.
Unser Komplett-Paket für Ihr Hinweisgebersystem
- Bereitstellung unserer persönlichen Erreichbarkeit der Ombudsperson im In- und Ausland (Telefon/persönliches Treffen/Post)
- Digitales Hinweisgebersystem, 24/7 erreichbar
- Anonymität für Hinweisgebende
- Plausibilitätsprüfung von eingehenden Hinweisen
- Einhaltung der gesetzlichen Fristen nach Eingang eines Hinweises
- Einmalige Erstellung einer Compliance Richtlinie
- Frühwarnsystem: Informationen zu neuen Compliance relevanten Gesetzen
- Datenschutz und Revisionssicherheit des Hinweisgebersystems
- Standardisierte Unterstützung der Unternehmenskommunikation zum Hinweisgeberschutz
- Hinweis: Individuelle Sachverhaltsaufklärung nach eingehenden Hinweisen beauftragen Sie gesondert
- Schulungsunterlagen für eine interne Vertrauensperson für Hinweisgeber.

Einmalige Beratung für Ihr Hinweisgebersystem
- Persönliche Beratung zur rechtssicheren internen Umsetzung eines Hinweisgebersystems (60 Minuten)
- Analyse der vorhandenen Strukturen
- Schulungsunterlagen für eine interne Vertrauensperson für das Hinweisgebersystem
- Erstellung einer Compliance Richtlinie
- Standardisierte Unterstützung der Unternehmenskommunikation zum Hinweisgeberschutz
Beitrag aus 25.05.2022
Die EU – Whistleblowing / Hinweisgeber- Richtlinie ist in Deutschland noch nicht umgesetzt worden. Seit April 2022 befindet sich ein neuer Gesetzentwurf des Bundesjustizministeriums im regulären Gesetzgebungsverfahren. Es wird erwartet, dass das neue deutsche Gesetz spätestens im Herbst 2022 in Kraft treten wird.
In diesen Beitrag möchten wir Ihnen einen Einblick in den aktuellen Stand geben und welche Kernpunkte die Umsetzung in Deutschland umfasst:
- Die Verpflichtung zur Einrichtung interner Kanäle gilt sowohl für den Privatsektor als auch für den gesamten öffentlichen Sektor, sofern die Organisation mindestens 50 Mitarbeiter beschäftigt.
- Der sachliche Anwendungsbereich des Gesetzes geht über eine 1:1-Umsetzung hinaus, um widersprüchliche Auslegungen oder Wertungen zu vermeiden. Er umfasst insbesondere alle Verstöße, die strafrechtliche Tatbestände darstellen. Darüber hinaus Verstöße, die unabhängig von ihrer EU-Herkunft bußgeldbewehrt sind, soweit die verletzte Vorschrift dem Schutz von Leib, Leben, Gesundheit oder den Rechten der Arbeitnehmer oder ihrer Vertretungsorgane dient.
- Whistleblowern steht es frei, ob sie sich an einen internen oder externen Kanal wenden wollen. Die zentrale externe Meldestelle auf Bundesebene wird das Bundesamt für Justiz sein
- Die Umsetzungsverpflichtung für private Unternehmen mit 50 bis 249 Beschäftigten wird zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich ab dem 17. Dezember 2023, fällig.
- Aufgrund des Ablaufs der Umsetzungsfrist könnte die EU-Whistleblowing / Hinweisgeber -Richtlinie zumindest für den öffentlichen Sektor unmittelbar anwendbar sein, da die meisten Bestimmungen klar und präzise formuliert, nicht an Bedingungen geknüpft und ihrer Natur nach geeignet sind, unmittelbare Wirkungen zu entfalten. Zudem für ihre Umsetzung keine weiteren Rechtsvorschriften erforderlich sind.
- Der Gesetzentwurf sieht in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Richtlinie verschiedene Schutzmaßnahmen für Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber vor. Zentrales Element ist das Verbot von Repressalien, d.h. von Nachteilen wie Entlassungen, Abmahnungen, Disziplinarmaßnahmen, aber auch von Rufschädigung oder Mobbing.
- Der Entwurf sieht nur wenige Regelungen zur Ausgestaltung eines Hinweisgebersystems in Unternehmen vor (z.B. Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten, Fallbearbeitung und interne Ermittlungen) und lässt den Unternehmen Flexibilität bei der eigenen Ausgestaltung. Staatliche oder private Organisationen/Einrichtungen sind nicht verpflichtet, die Abgabe von anonymen Hinweisen zu ermöglichen
- Der neue Entwurf erlaubt es Unternehmen – unabhängig davon, ob sie einem Konzern angehören – mit 50 bis 249 Beschäftigten, eine gemeinsame Stelle für die Entgegennahme von Hinweisen und das Fallmanagement einzurichten und zu betreiben. Darüber hinaus ermöglicht der deutsche Gesetzentwurf die Einrichtung eines zentralen internen Meldewegs bei einer Konzerngesellschaft in Konzernorganisationen unabhängig von der Unternehmensgröße.
- Die Umsetzung des Hinweisgebersystems kann Beteiligungsrechte des Betriebsrats nach sich ziehen.
- Der Gesetzentwurf enthält keine speziellen Datenschutzregelungen. Insoweit sind die allgemein geltenden datenschutzrechtlichen Anforderungen, insbesondere die datenschutzrechtlichen Bestimmungen der DSGVO, zu beachten.
- Verstöße gegen wesentliche Anforderungen des Gesetzes können als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden. Dies gilt z.B. für die Nichteinrichtung eines internen Meldewegs (Bußgeld bis zu EUR 20.000,00). Darüber hinaus sind Bußgelder von bis zu EUR 100.000,00 bei schwerwiegenden Verstößen (z.B. Verletzung der Vertraulichkeit, Ergreifen von Repressalien) möglich.
Schauen Sie auch gern auf unserer Hinweisgeber – Website vorbei. Wir haben eine eigene Hinweisgeber – Software mit den gesetzlichen Anforderungen und stehen zudem als externe Meldestelle für Sie zur Verfügung.
Schauen Sie dazu gern auf Edward360 vorbei:
 Edward360 Meldestelle
Edward360 Meldestelle
Sie haben weitere Fragen zur Whistleblower / Hinweisgeberrichtlinie ? Melden Sie sich gern bei uns:
Kontaktformular WIEMER ARNDT
Schauen Sie sich die detaillierten Beschlussempfehlung an:
https://dserver.bundestag.de/btd/20/067/2006700.pdf